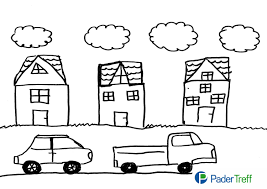Soeben noch das Meer im Rücken
Soeben noch das Meer im Rücken
und westlich Berge fern erspäht –
jetzt Ziegel, die den Ausblick schmücken,
der bis zur nächsten Ecke geht.
Ich kenn ihn. Ist sich treu geblieben,
seitdem ich abgereist von hier
und mich im Flieger eingeschrieben
als blind vertrau’nder Passagier.
Um südlicher zu überwintern
wie Vögel, die von dannen ziehn,
um sich nicht abzufriern den Hintern
im Billignest ohne Kamin.
Ich kenn ihn. Hat sie überstanden,
die Wind-und-Wetterjahreszeit
und zeigt mir stolz als noch vorhanden
sein dunkleres Fassadenkleid.
Da auf dem First (Hotelgebäude!)
die Flaggen, ausgefranst und matt,
sie flattern mir Willkommensfreude
für Deutschland und die Hansestadt.
Doch auch die ewig gurrend grauen
Genossen finden sich noch ein,
auf dem Balkon sich umzuschauen
nach Örtchen für ihr Taubenklein.
Wie immer brandet von der Straße
der Lärm von Mensch und von Motor
im Metropolen-Übermaße
auch noch dem 3. Stock ins Ohr.
Mit ständig wiederkehrnden Spitzen,
die noch erhöhn das Potenzial,
da viele Richtung Ampel flitzen
mit voller Pulle aufs Pedal.
So ist denn alles noch beim Alten.
Auf Eis lag gleichsam meine Welt.
Ich habe sie zurückerhalten
wie kurz im Keller abgestellt.
Muss ich mich da noch eingewöhnen,
‘ne Probezeit noch absolviern,
mich mit den Dingen auszusöhnen,
die mir jetzt fremd entgegenstiern?
Ich frag mich, ob ich weg gewesen.
Der Urlaub ist schon halb verblasst,
nur auf dem Ticket noch zu lesen,
dass ich die Reise nicht verpasst.
Verlorenes zurückgewinnen
heißt, dass es nie verloren ging.
Da wird wohl nicht viel Zeit verrinnen,
bis ich zum Rückflug auf mich schwing!